|
Bereits durch vorangegangenen Bergbau
in den Wittekindsberg getriebene Stollen dienten als
Grundlage für die Anlage mit dem Codenamen „Stöhr II“.
Von der SS-Sonderbauinspektion wurde für diese Anlage
ein Stollen ausgewählt, der sich etwa achtzig Meter
unterhalb des Kaiser-Wilhelm Denkmals befand und unter
diesem hindurch in Richtung Westen erstreckte – dem
sogenannten „Denkmalstollen“. Durch Verbindung dieses
Stollens mit benachbarten Stollen sollte somit ein
größerer Fertigungsbetrieb entstehen. Die
ehemalige Haupteinfahrt zu der Anlage „Stöhr II“ befand
sich etwa achtzig bis neunzig Meter unterhalb des
Denkmals. |
|
 | |
| Foto : Der Eingang zur Anlage Stöhr
II während des
Krieges | | |
|
Trotz der Pläne, durch eine Verbindung
zu benachbarten Stollen, einen weitaus größeren
Fertigungsbetrieb entstehen zu lassen, wurde die Anlage
„Stöhr II“ letztendlich nur unter Verwendung des
ursprünglichen Denkmalstollens errichtet. Anstelle der
genannten Einbeziehung anderer Stollen wurden beim Bau
drei Zwischendecken aus Beton eingefügt um somit
insgesamt vier Etagen für die geplanten Produktionen zur
Verfügung zu stellen.
Dies war dadurch möglich, dass der
ursprüngliche Stollen so erweitert wurde, dass für die
gesamte Anlage ein Stollen zur Verfügung stand, der
neunzig Meter lang, zwölf Meter breit und siebzehn Meter
hoch war. Zusätzlich wurden Treppenhäuser eingefügt,
welche die verschiedenen Etagen miteinander
verbanden. |
|
 | |
|
Der Eingangsbereich des Stollens wurde
durch eine schwere Bunkermauer vor Angriffen gesichert,
jedoch sind keine entsprechenden Angriffe bis zum Ende
des Krieges bekannt. Wie die meisten Anlagen dieser
Region wurde auch bei der Anlage „Stöhr II“ im Herbst
1943 mit dem Bau begonnen. Mitte 1944 soll der Bau der
Anlage „Stöhr II“ dann abgeschlossen gewesen sein. Im
September 1944 soll dann die Produktion auf allen Etagen
der Anlage unter Mithilfe von insgesamt vierhundert bis
fünfhundert Produktionskräften angelaufen sein. Welcher
Art diese Produktionskräfte waren, ist leider nicht
erwähnt, jedoch muss davon ausgegangen werden, dass sich
die Belegschaft fast ausschließlich aus Zwangsarbeitern
des Lagers Barkhausen zusammensetzte, da Berichten
zufolge der größte Teil dieser Arbeitskräfte
ausländischer Herkunft
war. | | |
|
In den ersten beiden Etagen war
die Firma Dr.Ing.Böhme & Co Metallwarenfabrik
Minden-Lübbeckerstrasse untergebracht. Hier wurden
kriegswichtige Kugellager der Durchmesser 5/8“ bis 2“
hergestellt. Die gesamte Fertigung soll einen
Nicht-Präzisions-Fertigung gewesen sein und nur der
Endmontage der Lager gedient haben. Die
präzisionsgefertigten Kugeln wurden zum Teil aus
Schweinfurt angeliefert, die Gehäuse von der Firma
oberirdisch in Minden gefertigt. |
|
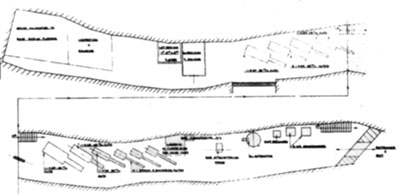 | |
|
Die Fertigung der Gehäuse sollte dann zu einem
späteren Zeitpunkt ebenfalls in die unterirdische
Produktionsanlage verlegt werden, somit wäre man nur
noch auf die Anlieferung der benötigten Kugeln
angewiesen gewesen. Um die Tragkraft der Decken nicht
unnötig hoch zu belasten wurden die schweren Drehbänke
ausschließlich im Erdgeschoss untergebracht. Da auch
hier Durchgänge von bestimmter Größe benötigt wurden,
ordnete man diese Maschinen schräg, mit einem Winkel von
27° zur Längsachse an. Die zum Härten der Werkstücke
benötigten elektrischen Schmelzöfen wurden in separaten
Räumen neben dem Hauptstollen untergebracht und befanden
sich auf beiden Etagen. Die Produktionsleistung lag
monatlich zwischen 250.000 und 350.000 Stück, die
Gesamtleistung der Anlage zwischen 1.000.000 und
3.000.000 Kugellagern im gesamten Produktionszeitraum
von sechs Monaten. Hinsichtlich der Produktionszahlen
sind keine genauen Daten bekannt, da sich die Angaben
der deutschen Ingenieure und die Schätzungen der
Alliierten zu sehr von einander unterscheiden. Von einem
Mittelmaß ist daher auszugehen. Die zweite und
dritte Etage wurde von der Firma „Atrupa“ aus Aachen
belegt. Diese Firma stellte Komponenten für die
Panzerfaust her. Hier lief die Produktion gegen Ende
Oktober 1944 an. |
| |
| Foto : Grundriss der unteren
Etage | | |
|
In der Decke der obersten Etage wurden
Lüftungskanäle eingebettet, um so die Belüftung der
Anlage zu gewährleisten. Die Belüftungsanlage
bestand aus einem Zuluft- und Abluftsystem. Die von
einem doppelten Ventilator angesaugte Außenluft wurde
durch einen Erhitzer geleitet und anschließend durch
zwei horizontale Befeuchterplatten befeuchtet. Letzteres
diente im Sommer dazu, die Luft zu kühlen und war im
Winter nicht in Betrieb. Die angesaugte Luft wurde
zusätzlich noch gereinigt, indem sie durch einen Wäscher
geleitet wurde, der von der Hauptwasserversorgung
gespeist wurde. Die Abwässer dieses Wäschers wurden
ebenfalls in die Weser geleitet. Die Regulierung der
Temperatur erfolgte nur über den Erhitzer. Andere
Regelfunktionen waren nicht vorgesehen. Die so
behandelte Zuluft wurde von der obersten Etage über ein
System aus senkrechten, lackierten Blechrohren auf die
verschiedenen Etagen der Anlage verteilt. Die bodennahen
Auslässe waren mit verstellbaren Lamellen ausgestattet
um eine geringfügige Regelung zu ermöglichen. Die Abluft
wurde über, in Deckenhöhe angebrachte, Ansaugrohre zum
Hauptabluftrohr geleitet. Für die anderen, vom
Hauptsystem getrennten Räume stand in der obersten Etage
ein separates Lüftungssystem zur
Verfügung. | |
| |
|
Die Druckluftversorgung erfolgte
über zwei wassergekühlte Kompressoren, welche im
Erdgeschoss aufgestellt waren. Von hier aus wurde
die Luft dann über ein Rohrsystem in die
entsprechenden Anlagenteile
weitergeleitet. | |
| | | |
|
Die Stromversorgung erfolge über eine
städtische 6 kV Leitung, die zum Transformator im
Kesselhaus führte. Hier wurde die Spannung auf 380V bzw.
220V herunter transformiert. Die einzelnen Leitungen
wurden dann unter Verwendung von Platten, welche an den
hölzernen Deckenstützbalken angebracht waren, in die
Anlage geführt. Als Beleuchtung dienten einfache
Glühlampen, welche sich in Leuchten befanden, die mit
polierten Eisenreflektoren ausgestattet waren. Diese
Beleuchtung zeigte sich als ausreichend, da alle Wände
der Anlage weiß gestrichen wurden. Erdungsmaßnahmen der
elektrischen Anlagen sind nicht
bekannt. | |
|
Der Transport von Materialien für
die Anlage erfolgte per Kleinbahn und mit Loren.
Innerhalb der Anlage wurden die betreffenden
Gegenstände dann über den eingebauten, mit zwei
Tonnen Tragkraft versehenen, Lastenaufzug
auf die einzelnen Etagen verteilt. Außerdem
bestand die Möglichkeit, Lasten durch einen, in
der dritten Etage befestigten, Flaschenzug direkt
auf die jeweilige Etage zu
verfrachten. |
|
|
Hierfür waren Öffnungen in der
Bunkermauer des Stolleneinganges vorhanden. Auf
den einzelnen Etagen wurden die Lasten dann
entweder per Hand, oder mit elektrisch betriebenen
Transportwagen
bewegt. | | | |
|
Nach
Kriegsende wurde die Anlage, wie alle anderen,
gründlich untersucht und danach versiegelt.
Auch hier wurde der
Haupteingang effektiv gesprengt. Die übrigen
Belüftungsschächte wurden mit Beton versiegelt,
noch verbleibende Öffnungen im Geröllhaufen
mittels Beton ebenfalls vergossen. Seit der
Sprengung ist diese Anlage hermetisch verschlossen
und bietet keinerlei Zugangsmöglichkeit
mehr.
|
| | |
| Fotos : Rechts : Sprengung der Anlage / Mitte :
Eingangsbereich heute / Links : Versiegelter
Eingang | |
|
|